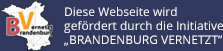80 Jahre Frieden - Geschichte eines Kelches
80 Jahre Frieden - Geschichte eines Kelches

Geschichte des romanischen Kelchs von Rathenow
Der spätromanische Abendmahlskelch und der dazu gehörige Brotteller (Patene) ist aus vergoldetem Silber und stammt wahrscheinlich aus Niedersachsen und wird in seiner Herstellung auf das Jahr 1260 oder 1280 datiert. Zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges (1618 – 1648) soll der Kelch auf dem Rathenower Friedhof vergraben worden sein. Da der Krieg sich aber über so viele Jahre hinzog, starben die Menschen, die ihn vergraben hatten und das Versteck geriet in Vergessenheit. Als 1637 Matthias Lüssow als neuer Superintendent, den man damals Inspektor nannte, nach Rathenow kam, hatte er an einem Tage bei hellem Licht eine Vision. Ein unsichtbarer Begleiter führte ihn über den Friedhof und blieb vor einem alten Grab stehen, aus dessen Tiefe ein goldener Kelch leuchtete. Als Matthias Lüssow bei alten Gemeindemitgliedern herumfragte, hörte er nur vage Gerüchte. Er ließ trotzdem an der Stelle graben und fand in großer Tiefe den goldenen Kelch und andere Abendmahlsgeräte in einer Holzkiste. Nach vielen Jahren der Benutzung geriet der kostbare Kelch in Vergessenheit. Das Gold war im Laufe der Jahre abgeputzt und der Kelch wurde unbeachtet in einem Schrank der Sakristei aufbewahrt. Ein neuer Kelch für 150,00 Mark war für die Feier des Abendmahls angeschafft worden. Eines Tages besichtigte ein Kunstkenner die Kirche, sah den alten Kelch und meinte, er sei von höchstem Wert. Der Gemeindekirchenrat entsandte ihn deshalb zum Leiter des Kunstgewerbemuseums in Berlin, Professor Lessing. Professor Lessing schätze ihn auf 5.000,00 Goldmark und bedauerte, dass das Museum ihn zurzeit nicht kaufen könne. Nach dieser Expertise wurde der Kelch im Tresor aufbewahrt und nur für das erste Abendmahl der Konfirmanden benutzt. 1914 bot ein Kunsthändler für den Kelch 15.000,00 Mark. Da die Gemeinde für den Neubau einer zweiten Kirche Geld benötigte, war die Versuchung groß, den Kelch zu veräußern. Nach internen Überlegungen wurde dem Käufer mitgeteilt, dass der Kelch unter 30.000,00 Mark nicht zu haben sei. Daraufhin erschien ein zweiter Kunsthändler, der angeblich im Auftrag eines holländischen Grafen 30.000,00 Goldmark und etwas später 50.000,00 Goldmark bot. Außerdem würde er bei einer Düsseldorfer Firma eine Kopie für 1.500,00 Mark in Auftrag geben, die nur ein Kenner vom Original unterscheiden könnte. 2.000,00 Mark wollte der Kunsthändler dem Superintendenten Georg Heimerdinger persönlich überreichen. Nach einer hitzigen Debatte im Gemeindekirchenrat war bei der Abstimmung Stimmengleichheit entstanden. Der Superintendent, Georg Karl Heimerdinger, gab letztendlich mit seiner Stimme den Ausschlag für das Verbleiben des Kelchs in der Gemeinde. Wenig später kam es zur Inflation (1914 -1923), sodass das angebotene Geld keinen Wert mehr gehabt hätte.
Vor 80 Jahren
Der Rathenower Pfarrer Ernst Detert gehörte im Zweiten Weltkrieg der Bekennenden Kirche an, die während der Nazi-Zeit gegen die Verfälschung des Evangeliums auftrat. Als im April 1945 die russischen Truppen sich immer mehr der Stadt Rathenow näherten, musste man damit rechnen, dass sie, wie überall sonst, plündern und rauben würden. Pfarrer Detert wusste, dass sich der Abendmahlskelch im Tresor des Kreishauses am Kaiser-Wilhelm-Platz befand. Als der Beschuss auf Rathenow schon begonnen hatte, nahm er sein Fahrrad und begab sich vom Kirchplatz zum Kreishaus. Er musste immer wieder Zuflucht in einem Torweg suchen, um nicht von einer Kugel getroffen zu werden. Er kannte den Hausmeister im Kreishaus, der ihm den kostbaren Kelch aus dem Tresor übergab. Er steckte ihn in seine Talartasche und stellte alles auf den Gepäckständer seines Fahrrades und radelte wieder zurück zum Kirchplatz. Die Rückfahrt war zufällig in einer Angriffspause und verlief deshalb unkompliziert. Aber nun stand er vor dem Problem, wo man den Abendmahlskelch vor den marodierenden Soldaten verstecken sollte? Der Kelch konnte zwar auseinandergeschraubt werden, aber in seinem Etui konnte er unmöglich aufbewahrt werden. Die Idee, ihn im Garten zu vergraben, wurde schnell verworfen, auch ihn im Hühnerfutter zu verstecken, schien nicht sehr realistisch. Pfarrer Ernst Detert hatte in seiner Wohnung eine Bibliothek mit Tausenden von Büchern. So versteckte er die drei Teile des Kelches hinter den Büchern der Bibliothek. Als die russischen Soldaten nach Rathenow kamen, haben sie Uhren, Ringe und alles Erdenkliche mit Gewalt an sich gebracht. Auch wurde der Pfarrer mit seiner Familie gezwungen, das Pfarrhaus zu verlassen und in das zehn Kilometer entfernte Dorf Stechow zu fliehen. Als er nach zwei Tagen ins Rathenower Pfarrhaus zurückkehren durfte, sah er, dass alles geplündert und geraubt worden war, aber den Kelch hinter den Büchern hatten russischen Soldaten nicht entdeckt. Nach mehreren Monaten gab es wieder eine Eisenbahnverbindung von Rathenow nach Berlin und Pfarrer Ernst Detert brachte den kostbaren Kelch zur neuen Kirchenleitung nach Westberlin in die Jebensstraße 3, wo er im Tresor blieb, bis ruhigere Zeiten die Rückkehr des Kelches nach Rathenow erlaubten. 1967 wurde der Kelch anlässlich des hundertjährigen Bestehens des Kunstgewerbemuseums in Berlin-Köpenick in einer Sonderausstellung gezeigt. Vom 31.08. - 06.12.2009 wurde der Romanische Kelch als einer der Schönsten in der Ausstellung
„ Aufbruch in die Gotik“ im Kulturhistorischen Museum in Magdeburg präsentiert. Bei feierlichen Gottesdiensten wird der Kelch heute aus einem Tresor geholt und dient wie seit über 700 Jahren seiner eigentlichen Bestimmung, Körper und Blut von Jesus Christus in Gestalt von Brot und Wein den Christen in Rathenow zu reichen. Durch diese Abendmahlsgemeinschaft mit dem lebendigen Christus ist auch die Rathenower Gemeinde mit allen Christen verbunden, die seit über 700 Jahren von diesem Brotteller (Patene) gegessen und aus diesem Kelch getrunken haben.
Dr. Heinz-Walter Knackmuß 12.04.2025